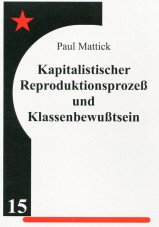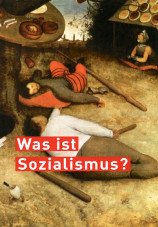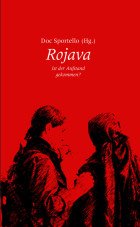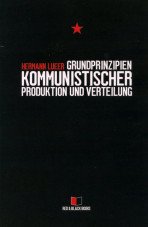- Details
- Kund*innen-Tipp
Produktbeschreibung
Zur Theorie und Praxis der Gruppe "Socialisme ou Barbarie" (1949-1967)
Noch bis vor kurzem galt die politische Gruppe um die Zeitschrift "Socialisme ou Barbarie" (1949-1967) in Deutschland als Geheimtip. In Frankreich hingegen war sie längst als wichtige Anregerin der Neuen Linken und des Mai "68 anerkannt. Im angespannten Klima des Kalten Krieges zwischen den Apologeten des westlichen Kapitalismus und den Anhängern des Stalinismus entwickelte die linkslibertäre Gruppe um Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Jean-François Lyotard, Henri Simon, Yvon Bourdet, Benno Sarel, Daniel Mothé und andere ihre undogmatischen marxistischen Positionen weiter zur radikalen Kritik am Marxismus selbst. In revolutionärer Absicht knüpfte sie an rätedemokratische Traditionen an und entdeckte das kreative Potential und die Selbsttätigkeit der Menschen als wichtigste Quelle der angestrebten Emanzipationsprozesse zu einer selbstbestimmten radikaldemokratischen Gesellschaft. Dieses Buch ist die erste ausführliche deutschsprachige Rekonstruktion der Geschichte von "Socialisme ou Barbarie". Es basiert neben der kritischen Auswertung der Zeitschrift auch auf einer Befragung ehemaliger Mitglieder der Gruppe. Ins Zentrum ihrer Darstellung rückt Andrea Gabler eine Analyse des Projekts einer "revolutionären Arbeitsforschung". Mit den "témoignages" - den authentischen Selbstzeugnissen der Arbeitenden aus ihrem Arbeitsalltag in Industrie und Verwaltung - begründete "Socialisme ou Barbarie" eine eigene Form von Aktionsforschung mit dem Ziel, die entfremdeten Arbeitsverhältnisse durch Selbstinterpretation der Alltagserfahrungen zu artikulieren, um sie verändern zu können.
Diese "témoignages" beleuchten detailliert den Despotismus bürokratisch-kapitalistischer Unternehmensorganisation. Auf dieser empirischen Basis entwickelt v.a. C. Castoriadis die Theorie der Gleichzeitigkeit von Einschluß und Ausschluß der Arbeitenden. Dieses Nebeneinander von Selbsttätigkeit (Autonomie) und betrieblicher Fremdbestimmung (Heteronomie) macht soziale Prozesse doppeldeutig und eröffnet neue Perspektiven emanzipatorischer politischer Praxis. Dieser theoretische Zugang kann aktuell die Diskussionen über Organisationswandel, neue Managementmethoden und die "Entgrenzung" von Arbeit, aber auch die Debatte um die Möglichkeit einer "anders organisierten Welt" kritisch anregen und konstruktiv weiterführen. Andrea Gabler zeigt, daß auch in den kleinen Konflikten und Widersprüchen des (Arbeits)- Alltags die Idee der Autonomie immer wieder als unabgegoltene Forderung aufscheint und zu neuen Aktionsformen anregt.
Buch, 294 Seiten
Kund*innen, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Der zweite Band der Reihe vereint vor allem Beiträge aus dem Umfeld der griechischen Gruppe Blaumachen über die verschiedene Aufstände in England, Schweden, der Türkei und Griechenland, Nordafrika und im Nahen Osten und versucht sich in einer Analyse der globalen Krise (die im Jahr 2008 begonnen hat) und der gegenwärtigen Sequenz des Klassenkampfes.
Ein Text der Gruppe "Solidarity" von 1972, der kurz und bündig auf 14 Seiten den Begriff "Sozialismus" definiert.
«Die nationalen Befreiungsbewegungen des 21. Jahrhunderts unterscheiden sich beträchtlich von jenen, als der Kolonialismus sich seinem Ende näherte und der Kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR in Form von lokalen Stellvertreterkriegen begann, mit einer beträchtlichen Anzahl an wechselnden Bündnissen und Millionen von Toten. Das kurdische Volk bezahlt einen umso höheren Preis, weil die Kurden zwischen vier Ländern verteilt sind. Doch die Gründe für die tiefe Veränderung in der nationalistischen Agenda sind nicht humanitäre Betrachtungen, ein Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit oder die Lektüre von authentischer kritischer Theorie. Nüchtern betrachtet ist ihre ehemalige Grundlage obsolet geworden.»