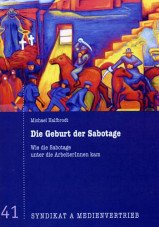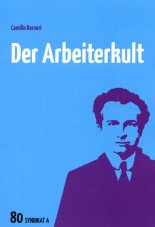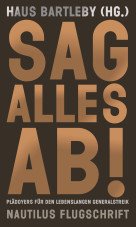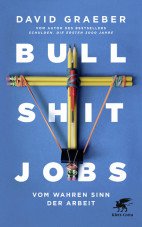- Details
- Kund*innen-Tipp
Produktbeschreibung
Arbeit. Eine globalhistorische Perspektive. 13. bis 21. Jahrhundert
Bei näherer Betrachtung erweist sich der Begriff „Arbeit“ als wahres Chamäleon, seine Definition ändert sich im historischen und im regionalen Kontext. Arbeit bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Mühe und Leid auf der einen Seite und kreativer Verwirklichung auf der anderen. Dieser Gegensatz, der auf das griechische „pónos“ und „érgon“ sowie das lateinische „labor“ und „opus“ zurückgeht, spiegelt sich in sämtlichen europäischen Sprachen wider. Erst die kapitalistische Rationalität hat Arbeit ihres Doppelcharakters beraubt und den Begriff auf produktive Erwerbstätigkeit verengt. Damit wurde all jenen Formen der Arbeit, die unbezahlt in der Familie, im Haus und in der Selbstversorgung erbracht werden, der Charakter von Arbeitstätigkeit abgesprochen.
Arbeit bestimmt wesentlich die Vorstellungen vom Sinn des Lebens. Ob aus religiöser Tugend, wie es die großen Weltreligionen verlangen, aus handwerklicher Berufsehre, aus familiärer Liebe und Sorge, aus sozialem Aufstiegswillen oder aus proletarischem Klassenbewusstsein ... Arbeit wird oft zum Lebenszweck erklärt. Der Verwirklichung in der Arbeit steht der Wunsch nach Befreiung von Arbeit gegenüber, der sich von der antiken Arbeitsverachtung über die asketische Überwindung der Bedürfnisse in klösterlichen Gemeinschaften bis hin zu technizistischen Utopien der Substitution menschlicher Arbeit durch Maschinen erstreckt. Die kritische Einstellung zur Arbeit kann darin zum Ausdruck kommen, Last und Mühe anderen Personen bzw. sozialen Gruppen aufzuhalsen. Sie kann sich aber auch in der Kritik an Zwangscharakter, Ausbeutung und Entfremdung sowie in kollektiven Aktionen zu deren Überwindung äußern.
In sechs Zeitschnitten zwischen dem 13. und dem 21. Jahrhundert zeigt Komlosy die Vielfalt der Arbeitsverhältnisse auf, die jede Periode kennzeichnet. Sie untersucht, wie Arbeit geteilt und in welcher Art sie miteinander kombiniert wurde. Die Verbindung unterschiedlicher Arbeitsverhältnisse ist die Grundlage der Kapitalakkumulation, die aus der Aneignung von Werten aus fremder Arbeit resultiert. Über ungleichen Tausch und die Zerlegung der Arbeitsprozesse in Güterketten liegt der Werttransfer auch der globalen Ungleichheit zugrunde.
Buch, 208 Seiten
Kund*innen, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Warum müssen wir, trotz all des technischem Fortschritts, mehr arbeiten als je zuvor? Wie kommt es, dass je härter wir arbeiten, wir letztendlich im Vergleich zu unseren Bossen umso ärmer werden? Warum konzentrieren sich die Leute einzig darauf, ihre Jobs zu retten, wenn die Wirtschaft zusammenbricht – obwohl eigentlich von vornherein keine_r die Arbeit mag? Kann der Kapitalismus ein weiteres Jahrhundert der Krisen überstehen?
"Ich erachte es wirklich als ein Zeugnis für schlechten Geschmack und halte es obendrein für schädlich, Bourgeoisie und Proletariat in der demagogischen Grobschlächtigkeit von Hintertreppenkarikaturen aus dem Repertoire des Avanti! oder irgendwelcher "Veranstaltungsredner" darzustellen zu wollen. Es ist leider immer noch eine fürchterlich plumpe sozialistische Rhetorik in Gebrauch, und die Kommunisten haben mehr als jede andere Avantgardepartei ihren Anteil daran, daß sie auch weiterhin Bestand haben wird. Noch nicht zufrieden mit dem "proletarischen Geist", haben sie noch zusätzlich die "proletarische Kultur" ins Spiel gebracht."
Ein Plädoyer für die Weltrevolution mit Stil - das Buch über Karriereverweigerung und das Ende der neoliberalen Epoche.