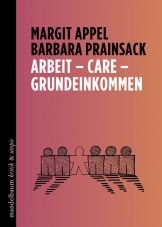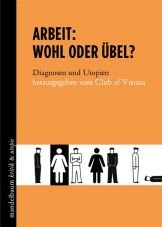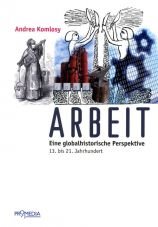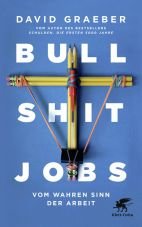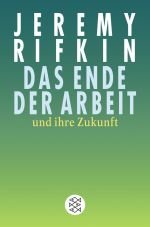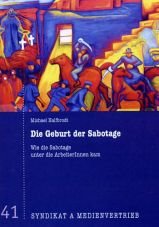Kampf der Lohnarbeit!
Kritik der Lohnarbeit
Ob bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht: Wir arbeiten ständig. Der globale Kapitalismus hat unsere Lebenszeit, unsere Subjektivität, unsere Erfahrungen, Wünsche und Sehnsüchte in nie dagewesener Weise zu Arbeit und zu Geld gemacht. Gleichzeitig wird die formale Lohnarbeit immer stärker prekarisiert. Packend zeichnen Mareile Pfannebecker und James A. Smith nach, wie sich ein Regime etablieren konnte, das sie Lebensarbeit nennen. Dabei stützen sie sich auf soziologische Erhebungen, philosophische wie politische Theorien, Berichte von Arbeiter*innen und Popkultur – von Adorno zu Tiqqun, von Jean-Luc Nancy zu Amy Winehouse.
Autor*innen: Mareile Pfannebecker; James A. Smith
Arbeit ist nicht nur ein Job – sie gestaltet Gesellschaft und Natur. Es ist von entscheidender Bedeutung, jene Prozesse, die Arbeit zu dem gemacht haben, was sie heute ist, zu verstehen und zu hinterfragen. Einerseits wird die bezahlte Arbeit der einen durch die unbezahlte Arbeit der anderen erst möglich gemacht. Gleichzeitig nutzt unser Wirtschaftssystem Arbeitsplatzargumente als Rechtfertigung für exzessives Wachstum, das Menschen und natürliche Ressourcen ausbeutet. Es zwingt uns in ein Hamsterrad, in dem wir funktionieren müssen, um zu überleben. Dieser Zwang beeinflusst nicht nur unser Leben, sondern auch die Zukunft unseres Planeten.
Autor*innen: Margit Appel, Barbara Prainsack
In den Beiträgen werden gegenwärtige Arbeitsverhältnisse thematisiert, die Autoren und Autorinnen zeigen aber auch auf, welche Veränderungen für eine zukünftige Neugestaltung der Arbeit notwendig sind, damit ein "gutes Leben" möglich ist - wie etwa auf das Bedingungslose Grundeinkommen sowie auf weitere politische Gestaltungspotenziale.
Autor*innen: Club of Vienna (Hg.)
Bei näherer Betrachtung erweist sich der Begriff „Arbeit“ als wahres Chamäleon, seine Definition ändert sich im historischen und im regionalen Kontext. Arbeit bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Mühe und Leid auf der einen Seite und kreativer Verwirklichung auf der anderen. Dieser Gegensatz, der auf das griechische „pónos“ und „érgon“ sowie das lateinische „labor“ und „opus“ zurückgeht, spiegelt sich in sämtlichen europäischen Sprachen wider. Erst die kapitalistische Rationalität hat Arbeit ihres Doppelcharakters beraubt und den Begriff auf produktive Erwerbstätigkeit verengt. Damit wurde all jenen Formen der Arbeit, die unbezahlt in der Familie, im Haus und in der Selbstversorgung erbracht werden, der Charakter von Arbeitstätigkeit abgesprochen.
Autor*innen: Andrea Komlosy. 13. bis 21. Jahrhundert
Autor*innen: David Graeber
Autor*innen: Jeremy Rifkin
Autor*innen: Paul Lafargue
Autor*innen: Paul Lafargue
Autor*innen: Paul Lafargue; Michael Wilk (Hg.)
"Ich erachte es wirklich als ein Zeugnis für schlechten Geschmack und halte es obendrein für schädlich, Bourgeoisie und Proletariat in der demagogischen Grobschlächtigkeit von Hintertreppenkarikaturen aus dem Repertoire des Avanti! oder irgendwelcher "Veranstaltungsredner" darzustellen zu wollen. Es ist leider immer noch eine fürchterlich plumpe sozialistische Rhetorik in Gebrauch, und die Kommunisten haben mehr als jede andere Avantgardepartei ihren Anteil daran, daß sie auch weiterhin Bestand haben wird. Noch nicht zufrieden mit dem "proletarischen Geist", haben sie noch zusätzlich die "proletarische Kultur" ins Spiel gebracht."
Autor*innen: Camillo Berneri
Autor*innen: Michael Halfbrodt
Diese Broschüre soll interessierten Menschen auf leicht verständliche Weise einen Einblick in die Logik des bundesdeutschen Arbeitsrechts bieten. Sie ist außerdem an Menschen gerichtet, die sich gemeinsam (kollektiv) organisieren möchten oder es sind, wie beispielsweise Gewerkschafterinnen, um die Arbeitsbedingungen der direkt und indirekt Lohnabhängigen zu verbessern. Sie dient aber auch dazu, persönliche (individuelle) arbeitsrechtliche Probleme, zumindest ansatzweise, einschätzen zu können. Sie soll Mut machen, anstehende Themen sowohl im individuellen- als auch im kollektiven Arbeitsrecht anzugehen und sich gegen das teilweise willkürliche Verhalten von Arbeitgeberinnen zur Wehr zu setzen.
Autor*innen: Thersites