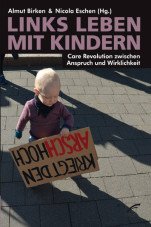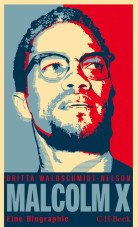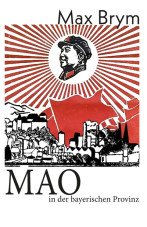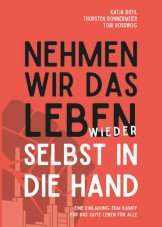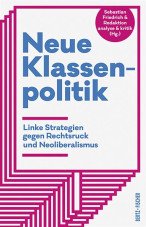Radikale Linke
Autor*innen: Leendert van Hoogenhuijze; Jasper Lukkezen; Bart van der Steen (Hg.)
„Linke und Gewalt“ dokumentiert Diskussionen der vergangenen 150 Jahre über die Rolle von Gewalt bei der Veränderung von politischen und sozialen Herrschaftsverhältnissen. Können auf staatlichen Gewaltmonopolen beruhende Systeme mit friedlichen Mitteln gestürzt werden oder ist Gewalt notwendig? Wenn ja, welche Formen sind in Bezug auf die Ziele zu rechtfertigen und welche nicht? Wie steht es mit Sabotage und „Tyrannenmord“? Wann wird der Revolutionär zum Terroristen bzw. der Guerillero zum Mörder?
Autor*innen: Felix Wemheuer (Hg.)
Autor*innen: Almut Birken; Nicola Eschen (Hg.)
Wohl kein anderer hat sich so radikal und sprachgewaltig für die Rechte der Schwarzen eingesetzt wie Malcolm X, der als „der zornigste Mann Amerikas“ galt. An seinem Beispiel führt dieses Buch in die afroamerikanische Geschichte und den Kampf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung ein. Dabei stützt es sich auf die neueste Forschung und neu erschlossenes Quellenmaterial sowie auf Gespräche mit Weggefährten und Angehörigen.
Autor*innen: Britta Waldschmidt-Nelson
Anfang der 70er Jahre brodelte es nicht nur in den Hauptstädten, nein, auch in der bayerischen Provinz, im sogenannten Chemiedreieck, gibt es rebellierende Jugendliche, die sich in K-Gruppen organisieren und den Aufstand proben. Sie legen sich mit der lokalen Bourgeoisie an, agitieren in Gaststätten für die Revolution und konfrontieren die Provinz mit ihrer braunen Vergangenheit. Allen voran der rote Max, der hier seinen politischen Werdegang schildert und Einblick gibt in die aufregende Zeit des linken Aufbruchs.
Autor*innen: Max Brym
Ausgelöst durch die internationale Solidarität mit den weltweiten antikolonialen Kämpfen dieser Zeit, entbrannte ab den 1970er-Jahren in der BRD eine Debatte über Militanz, in die sich etwa zwei Jahrzehnte lang vehement auch die radikal-feministische Gruppe Rote Zora einbrachte.
Autor*innen: FrauenLesbenBande (Hg.)
Mit geballter Faust in der Tasche - Über Klasse, Normen und die Linke. Autobiografische Perspektiven
Dieser Sammelband vereint autobiografische Zugänge linker Aktivist*innen aus Schweden zum Thema Klasse. Neben Ausschlüssen und Barrieren wird die Frage der Deutungshoheit thematisiert. So schreibt beispielsweise Frederic Carlsson-Andersson darüber, dass Klasse nur aus einer privilegierten Perspektive ein schwer greifbares Konzept sei, „von unten“ dagegen eine direkt erfahrbare, oft schmerzliche Realität.
Autor*innen: Kollektiv Stein und Wort (Hg.)
Von Abschaffen über FLTI* und Lauti bis Zusammenhang: Linke wollen nicht nur alles anders machen, sie reden auch anders. Das Lexikon der Bewegungssprache umfasst 150 Begriffe der außerparlamentarischen Linken. Manche sind für Außenstehende oder Neulinge völlig unverständlich, etliche werden anders verwendet, als man erwartet, oder sind zu abstrakt, um Leute auf die Straße zu bringen. 20 Autorinnen und Autoren bemühen sich um Aufklärung, teils sachlich, teils ironisch und immer kritisch-solidarisch. Das Buch ist ein Lexikon besonderer Art.
Autor*innen: Niels Seibert; Ines Wallrodt (Hg.)
Nehmen wir das Leben wieder selbst in die Hand. Eine Einladung zum Kampf für das gute Leben für alle
Was passiert, wenn ein VW-Arbeiter, ein Aktivist und eine Mobilitätsexpertin an einem Tisch sitzen? Ziemlich viel – und vor allem: Es knistert. Hier treffen Welten aufeinander, die sonst gerne gegeneinander ausgespielt werden: Fabrikhalle vs. Klimacamp. Blaumann vs. Fahrradhelm. Schichtplan vs. Systemwandel. Aber was wäre, wenn genau aus diesen Unterschieden etwas Gemeinsames entstehen kann? Ausgerechnet in Wolfsburg, mitten in der Höhle des Löwen der Automobilindustrie, wurde diese unwahrscheinliche Allianz Realität. Und sie zeigt: Es geht nicht darum, Autos zu hassen oder Arbeitsplätze zu feiern. Es geht darum, sich ehrlich zu fragen: Was brauchen wir wirklich? Und wer entscheidet das eigentlich?
Autor*innen: Katja Diehl, Thorsten Donnermeier, Tobi Rosswog
Autor*innen: Sebastian Friedrich; Redaktion analyse & kritik (Hg.)
»Ich bin parteilich, subjektiv und emotional. Nur auf diese Weise hab ich mir eh und je die Welt erschlossen.« So schreibt Inge Viett, der in den 70er Jahren das Prädikat »Top-Terroristin mit besonders grausiger Handschrift« verliehen wurde, auch über ihr Leben: über die enge, muffige Kindheit bei Pflegeeltern in der norddeutschen Provinz, ihre Zeit in der Berliner Subkultur und den Beginn des politischen Engagements. 1968 protestiert sie gegen die Unterdrückung der Frauen und setzt mit Molotow-Cocktails Geschäfte für Brautmode und Sexshops in Brand. Sie radikalisiert sich, bricht zweimal aus dem Gefängnis aus, ist beteiligt an der Lorenz-Entführung, an Gefangenenbefreiungen und militärischen Ausbildungen in palästinensischen Camps. Als sich die Bewegung 2. Juni auflöst, schließt sie sich der RAF an.
Autor*innen: Inge Viett
Autor*innen: Verein für angewandte Geometrie