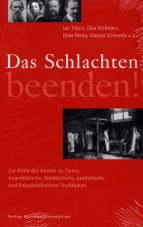- Details
- Kund*innen-Tipp
Produktbeschreibung
Prekarisierung als Klassenfrage
Innerhalb einer bemerkenswert kurzen Zeitspanne haben sich die Sozialverhältnisse auch in den Metropolenländern dramatisch verändert. Die Armutsquote hat in Deutschland die 20-Prozent-Marke erreicht und eine ebenso große Gruppe ist beständig vom sozialen Absturz bedroht.
Die Lebensverhältnisse sind bis weit in "mittlere" Soziallagen hinein von zunehmender Unsicherheit, oft auch Perspektivlosigkeit geprägt. Wie in früheren Zeiten des Kapitalismus reicht für viele auch eine ganztätige Erwerbsarbeit nicht mehr zum Lebensunterhalt. Über diese Verarmungstendenzen in weiten gesellschaftlichen Bereichen und die zunehmenden Ausgrenzungsprozesse kann auch eine ideologisch angepasste Sozialwissenschaft nicht mehr schweigen. Forschungen über soziale Randständigkeit haben sich sogar zu einem akademischen Gewerbezweig entwickelt, der wichtige Einzelaspekte erhellend bearbeitet hat, oft aber auch bemüht ist, die Ursachen der sozialdestruktiven Entwicklungen zu verschleiern: Die Prekarisierungs-, Spaltungs- und Ausgrenzungsprozesse werden - der Faktenlage zum Trotz - als Entwicklungen jenseits der Klassenspaltung interpretiert.
Aber erst durch einen klassentheoretisch fundierten Blick wird deutlich, dass die durch die "Arbeitsmarktreformen" bewirkten sozialen Entwurzelungen Konsequenzen eines neuen Modus sozialer Herrschaft sind.
Buch, 280 Seiten
Kund*innen, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Was ist Eigentum? Wem sollte was gehören und warum? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich die philosophische Eigentumstheorie. In kritischer Auseinandersetzung mit einschlägigen Positionen von Aristoteles über John Locke und Karl Marx bis hin zu John Rawls legt dieser Band die eigentumstheoretischen Grundlagen frei, auf denen gesellschaftspolitische Streitfragen unserer Zeit diskutiert werden. Dabei werden die verschiedenen Rechtfertigungen des Eigentums nachgezeichnet, ideengeschichtliche Zusammenhänge hergestellt und die Frage nach den Grenzen und Schranken des Eigentums behandelt. Ob beim Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum oder der Frage, wem die Daten gehören sollten: Wie Niklas Angebauer und Tilo Wesche aufzeigen, setzt jede überzeugende Begründung von Eigentum zugleich dessen Begrenzung voraus.