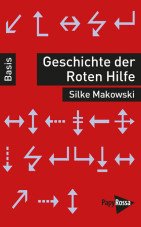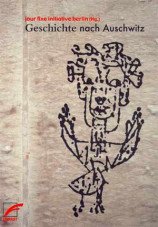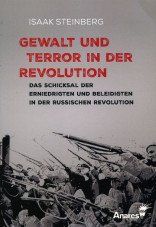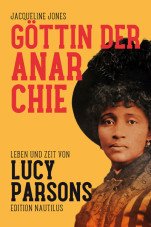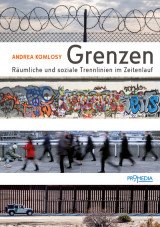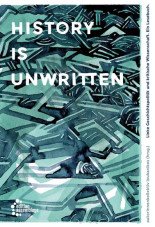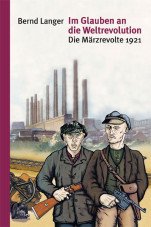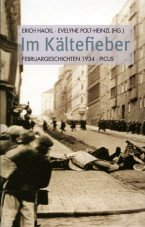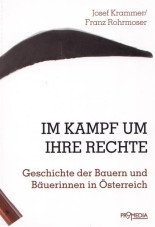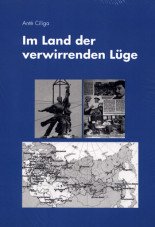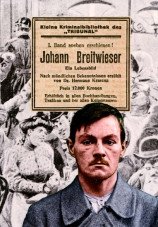sonstige Geschichte
Geschichte der ArbeiterInnenbewegung usw.
»Schafft Rote Hilfe!«, »Helft!«, »Solidarität organisieren!«: Slogans wie auch Logos änderten sich in der über hundertjährigen Geschichte der Roten Hilfe. Unverändert blieb die Praxis der Unterstützung linker Aktivistinnen und Aktivisten gegenüber staatlicher Repression – finanziell, juristisch und durch Öffentlichkeitsarbeit. Der Band skizziert die Solidaritätsarbeit der Rote-Hilfe-Organisationen von den Anfängen bis heute. Die 1924 gegründete KPD-nahe, aber parteiübergreifende Rote Hilfe Deutschlands (RHD) umfasste in der Weimarer Republik zuletzt rund eine Million Mitglieder. Politischen Gefangenen und deren Familien stand sie materiell zur Seite, finanzierte Rechtsbeistände und protestierte gegen Gesetzesverschärfungen. Ab März 1933 konnte sie in der Illegalität noch mehrere Jahre effektiv agieren.
Autor*innen: Silke Makowski
Autor*innen: Jour-fixe Initiative (Hg.)
Der renommierte Historiker Marcus Rediker erkundet die Welt der Atlantik-Seefahrt vom späten 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert aus Sicht rebellischer Seeleute, Sklav_innen und anderer Gesetzloser. Rediker zeigt, dass der »buntscheckige Haufen«, multiethnisch zusammengesetzte Gruppen maritimer Arbeiter, eine treibende Kraft hinter der amerikanischen Revolution war und verfolgt die Ideen und Praktiken dieser Arbeiter zurück bis zu den Freiheits- und Gleichheitsidealen der englischen Revolution.
Autor*innen: Marcus Rediker
Das Buch gehört neben Reiseberichten wie „Der Niedergang der russischen Revolution“ von Emma Goldman zu den frühen, wichtigen Zeugnissen jener Phase, als die Revolution zu Gunsten der sich herausbildenden autoritären Staatsmacht erstickt wurde. Steinberg geht auch auf die französischen Jakobiner, auf Robespierre und Danton ein, er zieht eine Linie zu den Bolschewiki. Steinberg hatte Kontakt zu Anarchisten wie Rudolf Rocker, aber auch z.B. zu Franz Pfemfert. Steinberg wurde bereits 1918 von den Bolschewiki verfolgt, entkam nach Berlin und arbeitete dort mit den Anarcho-Syndikalisten zusammen.
Autor*innen: Isaak N. Steinberg
Lucy Parsons, nie gehört? Nun, sie war eine der bekanntesten Anarchist*innen Amerikas, Wortführerin der US-Arbeiterbewegung, eine der radikalsten Schwarzen Frauen des späten 19. Jahrhunderts. Trotzdem ist sie hierzulande höchstens als Witwe von Albert Parsons bekannt, einem der fünf Anarchisten, die nach dem Haymarket-Aufstand von 1886 hingerichtet wurden. Dabei hat sie ihren Mann um Jahrzehnte überlebt und war so viel mehr als bloß »die Witwe«: Mitgründerin der IWW, Gewerkschafterin, Rednerin, Autorin, Herausgeberin, Briefpartnerin von Pjotr Kropotkin, Errico Malatesta, Johann Most, Emma Goldman und vielen anderen. Zu ihrem Schwarzsein hatte sie jedoch ein ambivalentes Verhältnis, die Klassenfrage stand für sie zeitlebens im Vordergrund.
Autor*innen: Jacqueline Jones
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs triumphierte die Ideologie der Grenzenlosigkeit. Systembarrieren waren gefallen. Innerhalb des EU-Schengenraumes wurden die Binnengrenzen aufgehoben. Es schien, als würde es demnächst keine Grenzen auf der Welt mehr geben. Doch bald kippte die Euphorie um die proklamierte Grenzenlosigkeit. Sie machte dem Ruf nach Wiedererrichtung von Grenzen Platz: gegenüber MigrantInnen, gegenüber chinesischen Firmenübernahmen, gegenüber einer Islamisierung der europäischen Gesellschaft und vielen anderen „fremden“ Einflüssen. Tatsächlich beruhte das Zeitalter der offenen Grenzen auf einer rigiden Abschottung gegenüber Menschen aus Drittstaaten. Die Grenzen waren nicht aufgehoben, sondern hatten sich lediglich verlagert. Umgekehrt bedeutet das aktuelle Revival von Grenzen keineswegs ein Ende der grenzenlosen westlichen Einmischung überall auf der Welt, sowohl in ökonomischer als auch in militärischer Hinsicht.
Autor*innen: Andrea Komlosy
Was macht die Linke mit Geschichte? 25 Antworten und Wortmeldungen aus Aktivismus, Kunst und Wissenschaft.
Ob Kolonialismus im Kasten oder Tränen in der Wissenschaft, ob Rosa Luxemburg oder Subcomandante Marcos, ob Ausgraben und Erinnern oder Kämpfen und Zweifeln - zusammen ergeben die Beiträge einen vielfältigen Eindruck von einer Linken, die sich um die Vergangenheit scheren muss, wenn sie etwas von der Zukunft will.
Autor*innen: AutorInnenkollektiv Loukanikos (Hg.)
Im März 1921 verschärfen sich die bewaffneten Aktionen militanter Arbeiter*innen, die die Regierungstruppen mit Plünderungen, Bankrauben und Sprengstoffattentaten sowie Zugentgleisungen auf Trab halten. Gegen Ende des Monats wird dann sogar der Generalstreik im ganzen Reich ausgerufen, der allerdings nur wenige Tage andauern und hohen Blutzoll kosten wird.
Autor*innen: Bernd Langer
2014 jährt sich der österreichische Bürgerkrieg zum achtzigsten Mal. Der Aufstand der Arbeiterschaft und des Republikanischen Schutzbunds gegen das austrofaschistische Regime am 12. Februar 1934 wurde von den Heimwehrverbänden und dem Militär brutal niedergeschlagen. Der kaltblütige Beschuss der Arbeiterwohnhäuser stellt eine entscheidende politische Zäsur auf dem Weg zum März 1938 dar. »Im Kältefieber« ist die bislang umfangreichste Anthologie zu den Februarkämpfen, mit vielen literarischen Entdeckungen österreichischer ebenso wie ausländischer Autorinnen und Autoren und Texten, die hier erstmals auf Deutsch publiziert werden.
Autor*innen: Erich Hackl; Evelyne Polt-Heinzl (Hg.)
Autor*innen: Josef Krammer; Franz Rohrmoser
Autor*innen: Anté Ciliga
Autor*innen: Dr. Hermann Kraszna