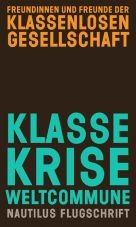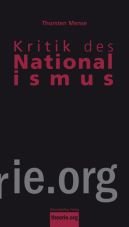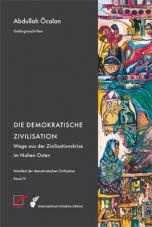Staat und Nation
Staat, Staatskritik und Kritik der Nation / des Nationalismus
Auf neuen Schauplätzen fand in den vergangenen Jahren ein deutscher Nationalismus seine Renaissance: In Musik und Sport setzte sich ein ungehemmtes Feiern schwarz-rot-goldener Einigkeit und Normalität durch. Gängige Unterhaltungsformate wurden zum bevorzugten Inszenierungsmedium - auch eines deutschen Opfermythos. Das Prädikat "deutsch" avancierte zum Leitbegriff erfolgreicher Werbestrategien. Erscheinen solche Momente auf den ersten Blick noch als unpolitisch, so zeigt sich in der wechselseitigen Verstärkung von Reartikulation und Rekonstruktion von Nationalem - und damit der Akzeptanz hegemonialer Projekte - eine riskante politische Dimension.
Autor*innen: Projektgruppe Nationalismuskritik (Hg.)
Das neu gegründete Jahrbuch für marxistische Gesellschaftstheorie versteht sich als Reaktion auf und als Alternative zur akademistischen Entwicklung im Wissenschaftsbetrieb. Es positioniert sich aber auch in Abhebung von marxologischen Publikationsprojekten: Das Marxsche Denken soll nicht philologisch rekonstruiert werden, sondern den Hintergrund einer Reflexion gesellschaftlicher Entwicklungen bilden. Dieses Denken zum Fundament zu erklären bedeutet, es zum Ausgangspunkt einer Reflexion auf die gesellschaftliche Wirklichkeit sowie der Analyse und Kritik theoretischer Positionen zu nehmen. Schwerpunkte der ersten Ausgabe sind »Staatskritik« und »Marxistisches Denken«. Neben dem Schwerpunkt gehen die Beiträge Nietzsche und dem Linksnietzscheanismus nach, kritisieren neoliberale Arbeitsutopien, untersuchen den Zusammenhang von Monopol, Medien und Ideologie oder spüren der »Drachensaat des Hegelianismus« nach.
Autor*innen: Redaktionskollektiv des "Jahrbuch für marxistische Gesellschaftstheorie" (Hg.)
Autor*innen: Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft
Anton Pannekoeks Schrift von 1912 ruft eine Zeitwende in Erinnerung, als die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts aus ihrer internationalistischen Perspektive heraus den Weg zur Nation fand. Seine Kritik an diesem nationalistischen Opportunismus zeigte eine Alternative auf, die es am Vorabend des Ersten Weltkrieges gab, die aber bedeutungslos blieb. Die Neuauflage von Pannekoeks Buch kann als Denkanstoß für die heutige Zeit wirken, in der - wie damals - unter tatkräftiger sozialdemokratischer Mitwirkung der Krieg als unvermeidbares Mittel der Politik propagiert wird.
Autor*innen: Anton Pannekoek
Dieser Band stellt kritische Nationalismus-Theorien verständlich und kompakt dar, erweitert sie und bringt die Kritik des Nationalismus auf den aktuellen Stand. Der Autor setzt Nationalismus als Ideologie in Zusammenhang mit der kapitalistischen Moderne und entwirft das Bild einer Kritischen Theorie der Nation. Darüber hinaus liefert er einen historischen Überblick revolutionärer nationaler und nationalistischer Bewegungen, beschreibt die Verschränkung von Emanzipation und Unterdrückung im Nationalismus und zeichnet die Debatten in der Linken zu Nation und Nationalismus von den Anfängen bis zur Gegenwart nach. Das Buch zeigt die Grenzen nationaler Befreiung auf und fragt nach den Möglichkeiten antinationaler Kritik.
Autor*innen: Thorsten Mense
Im hier vorliegenden ersten Band »Zivilisation und Wahrheit« kritisiert Öcalan die Kapitalistische Moderne als vorläufigen Endpunkt der Geschichte und weitet dabei den Blick auf die zugrunde liegenden Strukturen aus. Es steht für ihn außer Frage, dass die Kapitalistische Moderne nur eine Zivilisationsform unter vielen möglichen darstellt. Ohne die wesentlichen Stränge der zivilisatorischen Entwicklung zu verstehen, ohne ihre jeweiligen revolutionären wie reaktionären Phasen zu untersuchen (z.B. des Christentums oder des Islam), kann die Kapitalistische Moderne aber weder erklärt noch überwunden werden.
Autor*innen: Abdullah Öcalan
»Kapitalismus ist nicht Wirtschaft, sondern Herrschaft.« Im zweiten Band seines fünfteiligen Werkes kritisiert Öcalan die kapitalistische Moderne als vorläufigen Endpunkt der Geschichte und weitet dabei den Blick auf die zugrunde liegenden Strukturen aus. Ausgehend von den Analysen Fernand Braudels kritisiert er den Kapitalismus als eine Verirrung, die niemals fortschrittliches Potenzial besaß, sondern prinzipiell die Gesellschaft im Inneren zerstört, und beschreibt im Weiteren dessen reaktionäre Entwicklung durch die Idee des Nationalstaats, den historischen Nationalismus und den Faschismus.
Autor*innen: Abdullah Öcalan
Autor*innen: Abdullah Öcalan
Die globale Zivilisationskrise zeigt sich heute am deutlichsten in den herrschenden Verhältnissen des Nahen Ostens. Abdullah Öcalan legt nahe, dass dort, wo vor 5.000 Jahren die Zentralzivilisation ihren Anfang nahm, auch der Schlüssel zu ihrer Überwindung zu finden sein muss. Die demokratische Zivilisation beleuchtet die geschichtlichen Ursachen der globalen Krise genauso wie die vielfältigen Traditionen von Widerstand – religiöse, kulturelle, dezentrale – und vor allem deren Potenziale, die kapitalistische Moderne zu überwinden.
Autor*innen: Abdullah Öcalan
Die Analysen des Staates gehen in der Linken weit auseinander. Das Spektrum der Interpretationen reicht von der Idealisierung bis zur Dämonisierung, von der Übernahme des Staates bis zu seiner Abschaffung. Während der Staat für die einen als Garant des Allgemeinwohls gilt, betrachten ihn andere als das Instrument der kapitalistischen Klassenherrschaft und wieder andere sehen in ihm das Terrain sozialer Kämpfe. In seiner Einführung präsentiert Moritz Zeiler die zentralen Thesen marxistischer Theorie zum Staat: Die fragmentarischen Überlegungen bei Marx und Engels, die instrumentelle Staatstheorie bei Lenin, die Hegemonietheorien des Westlichen Marxismus von Gramsci, Althusser und Poulantzas sowie die Analysen von Paschukanis zum Verhältnis von Warenform, Rechtsform und Staatsform und später daran anknüpfende Arbeiten von Agnoli, Hirsch, Holloway und anderen. Ebenso zeichnet das Buch die linken Debatten über das Verhältnis von Staat und Faschismus nach – geht aber auch auf libertäre Staatskritik, feministische Ansätze und aktuelle Herausforderungen ein.
Autor*innen: Moritz Zeiler
Autor*innen: Siegfried Jäger; Alfred Schobert (Hg.)
Autor*innen: Sebastian Friedrich; Patrick Schreiner (Hg.)